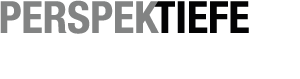Weniger ist mehr!
HINTERGRUND: Als Julius Caesar und seine Armee einmal mehr von dem bekannten, unbeugsamen gallischen Dorf vernichtend geschlagen werden, geht der große Feldherr aufs Ganze: Wenn die Gallier zwölf scheinbar unüberwindbare Aufgaben bestünden, ziehe er sich ins Privatleben zurück und übertrage ihnen die Herrschaft über das Römische Reich – so der Inhalt des Films „Asterix erobert Rom“. Es ist vor allem eine dieser Aufgaben, die es ins kollektive Gedächtnis mehrerer Generationen und in die Zitatensammlung jedes selbst ernannten Bürokratiebekämpfers geschafft hat: Asterix und Obelix sollen den harmlos anmutenden Passierschein A38 besorgen und entgehen in den Fängen der Bürokratie alias das Haus, das Verrückte macht, nur knapp dem Wahnsinn.
von: Dr. Jennifer Achten-Gozdowski, Referat Wirtschaft & Finanzpolitik des ZGV
Dieses Gefühl hat sich in den letzten Jahren bei vielen Bürgerinnen und Bürgern völlig jenseits der Zeichentrickwelt prominent entfaltet. Folgerichtig und stets am Puls der Zeit setzt sich auch kein Politiker mehr ohne das Versprechen des baldigen Bürokratieabbaus im Gepäck in eine deutsche Talkshowrunde und das ganze Land hofft auf die angekündigte entfesselnde und befreiende Wirkung. Doch was hat die Bürokratie eigentlich so in Verruf gebracht und darf man realistischerweise einen echten Umschwung erwarten?
Zu viel des Guten
Eigentlich war und ist Bürokratie als fortschrittlicher und wohltuender Kontrapunkt zu staatlicher Willkürherrschaft gedacht. Verwaltungen sichern durch den Vollzug geltenden Rechts eine staatliche Ordnung, die Privatleute wie Unternehmen vor unfairen Praktiken und herrschaftlichem Ermessen schützt. Bürokratien sind durch Unparteilichkeit, Regeltreue und Rationalität gekennzeichnete Organisationsformen, die verlässlich und effizient das organisierte menschliche Zusammenleben begleiten – so das idealistische Bild Max Webers, das es bis ins Beamtenstatusgesetz geschafft hat.1 Die Organisationsform selbst wie auch die daraus hervorgehenden Vorschriften, Pflichten und der damit verbundene Aufwand werden als Bürokratie bezeichnet.2 Und die wächst allem Protest zum Trotz seit Jahren massiv an. Unterschiedliche Erklärungsansätze dafür liefern Wissenschaft und Praxis gleichermaßen: Die politische Ökonomie zum Beispiel rüttelt am Bild des uneigennützigen und effizienten Bürokraten als Befehlsempfänger der politischen Ebene und spricht ihm stattdessen ganz eigennützig-menschliche Interessen zu. Ganz oben auf der Liste steht dabei, Einkommen, Macht und Ansehen zu maximieren. Im engen staatlichen Korsett gibt es dafür nicht besonders viele Stellschrauben, sondern die Möglichkeiten eines leitenden Beamten beschränken sich darauf, entweder umfangreiches Stabspersonal zu halten (lies: mehr als man bräuchte) oder die Aufgaben und den Umfang seines Ressorts aufzublähen. Beides erhöht das Budget, die eigene Wichtigkeit und die des Aufgabenbereichs und fungiert als zuverlässige Sperre gegen Abbau- und Verschlankungswünsche.3
„Problematisch wird Bürokratie dann, wenn sie nicht mehr als hilfreich erlebt wird, sondern behindert. Dieser Punkt scheint in Deutschland längst erreicht.“
Dr. Jennifer Achten-Gozdowski
Aus der Politikwissenschaft stammt eine alternative Erklärung für anwachsende und überbordende Bürokratie. Sie basiert auf der Vorstellung, dass steigender Wohlstand einer Gesellschaft zu veränderten Werten und Ansprüchen führt, denen die Politik mit zusätzlicher Gesetzgebung und Regulierung begegnet. Ist jede neue Regel für sich genommen oft wohl begründet, führen sie in der Fülle doch zu wechselseitiger Einflussnahme, immer komplexerem Abstimmungsbedarf und umfangreicherem Verwaltungsvollzug. Sowohl die anwachsende Größe als auch die viel bespöttelte Langsamkeit der Bürokratie sind damit erklärlich.4 Analysen aus der Praxis untermauern die Theorie. Der Sachverständigenrat bescheinigt der deutschen Bürokratie im aktuellen Frühjahrsgutachten eine ausgeprägte Risikoaversion und einen deutlichen Fokus auf juristisch fehlerfreie Durchführung. Diese starke Verfahrensorientierung und Vollkaskomentalität resultiert in aufwändigen und langen bürokratischen Prozessen. Dass Führungspositionen in der deutschen Verwaltung zu 45 % von Juristen bekleidet werden und nur rund 9 % der Führungskräfte Berufserfahrung in der Privatwirtschaft gesammelt haben, zementiert vollends die Strukturen.5 Prädikat: abbauresistent.
Wenn lästig zur Existenzfrage wird
Problematisch wird Bürokratie dann, wenn sie nicht mehr als hilfreich erlebt wird, sondern behindert. Dieser Punkt scheint in Deutschland längst erreicht. Wer 6 Monate auf die Geburtsurkunde seines Kindes warten muss, kann in dieser Zeit weder Kinder- noch Elterngeld beantragen oder ins Ausland reisen, da das Kind offiziell nicht existiert.6 Das ist individuell lästig; gesellschaftlich gefährlich aber wird es im Unternehmenskontext. Industrieunternehmen sind mit durchschnittlich 200 Behördenkontakten pro Jahr ständig auf die bürokratischen Strukturen angewiesen. Und das mit zunehmender Tendenz: Seit 2012 ist allein die Anzahl der bundesrechtlichen Verpflichtungen um 20,5 % gestiegen. Der Erfüllungsaufwand – also die Kosten für die Einhaltung von Vorschriften – beläuft sich für Unternehmen auf rund 65 Milliarden Euro jährlich, über 1 Milliarde Arbeitsstunden entfallen auf Informationspflichten und Berichtswesen.7 Diese Zahlen bilden dabei nur die Untergrenze, da weder der „Einmalaufwand“ für Unternehmen bei Neueinführung einer Vorschrift oder Regelumstellung erfasst wird noch der Erfüllungsaufwand, der sich aus der Umsetzung von EU-Regularien ergibt. Und der schlägt mit rund 57 % des Gesamtaufwands noch viel stärker zu Buche als der der nationalen Regeln.8
Sind die Kosten für die einzelnen Unternehmen schon hoch, so sind sie für die Gesellschaft insgesamt noch viel höher. Überfordernde und überbordende Bürokratie senkt die Standortattraktivität Deutschlands erheblich: Unternehmen bremsen ihre Investitionen, verlagern Produktionsstätten ins Ausland und Unternehmensneugründungen in Deutschland gelten als zunehmend unattraktiv.9 Dies verringert den Wettbewerb, kostet Arbeitsplätze und sorgt auf längere Sicht für höhere Preise und eine geringere Produktvielfalt. Keine gute Ausgangslage für ein Land, das sich im Transformationsprozess befinden sollte.
Nötig wäre ein grundlegender Schwenk in der Attitüde: Statt einer Kultur des Misstrauens, wie es viele Unternehmen angesichts der lähmenden Bürokratieanforderungen empfinden, braucht es eine Ermöglichungs- und Vertrauenskultur. Privatleute müssen ihr rechtskonformes Handeln nicht vorauseilend nachweisen – niemand muss z. B. ein Foto seines Parkscheins machen und an das Ordnungsamt schicken.10 Diese Maxime sollte auch für Unternehmen gelten und erklärtes Ziel muss sein, dass man nicht – um mit Reinhard Mey zu sprechen – vor jeder Handlung erst einen Antrag auf Erteilung eines Antragformulars stellen muss. Haken dran, Stempel drunter, Datum drauf, los geht’s!
Quellen:
1 Vgl. § 33 BeamtStG.
2 Vgl. Statistisches Bundesamt: www.destatis.de/DE/Themen/Staat/Buerokratiekosten/_inhalt.html.
3 Vgl. z. B. Blankart (1975): Zur ökonomischen Theorie der Bürokratie. Diskussionsbeiträge Nr. 56, Universität Konstanz.
4 Vgl. Schmidt (2024): Ergebnisorientierte Bürokratie gestalten. In: ifo Schnelldienst 11/24, S. 12.
5 Vgl. Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (2025): Frühjahrsgutachten, S. 157–161.
6 Vgl. www.haz.de/lokales/umland/uetze/sechs-monate-warten-wann-kommt-lukas-geburtsurkunde-BV6M6A6ZDWGQFR7FUBW6UE46LU.html.
7 Vgl. Nationaler Normenkontrollrat (2024): Jahresbericht 2024: Gute Gesetze. Digitale Verwaltung. Weniger Bürokratie, S. 73 ff.; sowie Sachverständigenrat (2025), S. 136 und S. 146.
8 Vgl. Gönner (2024): Bürokratie als Wachstumsbremse: Herausforderungen und Lösungsansätze für den Industriestandort Deutschland. In: ifo Schnelldienst 11/24, S. 31.
9 Vgl. Metzger (2025): Blitzbefragung: Was Selbstständige und Gründende von der Politik erwarten – Bürokratieabbau zentrales Anliegen. In: KfW Research Nr. 493.
10 Vgl. Gönner (2024): S. 32.